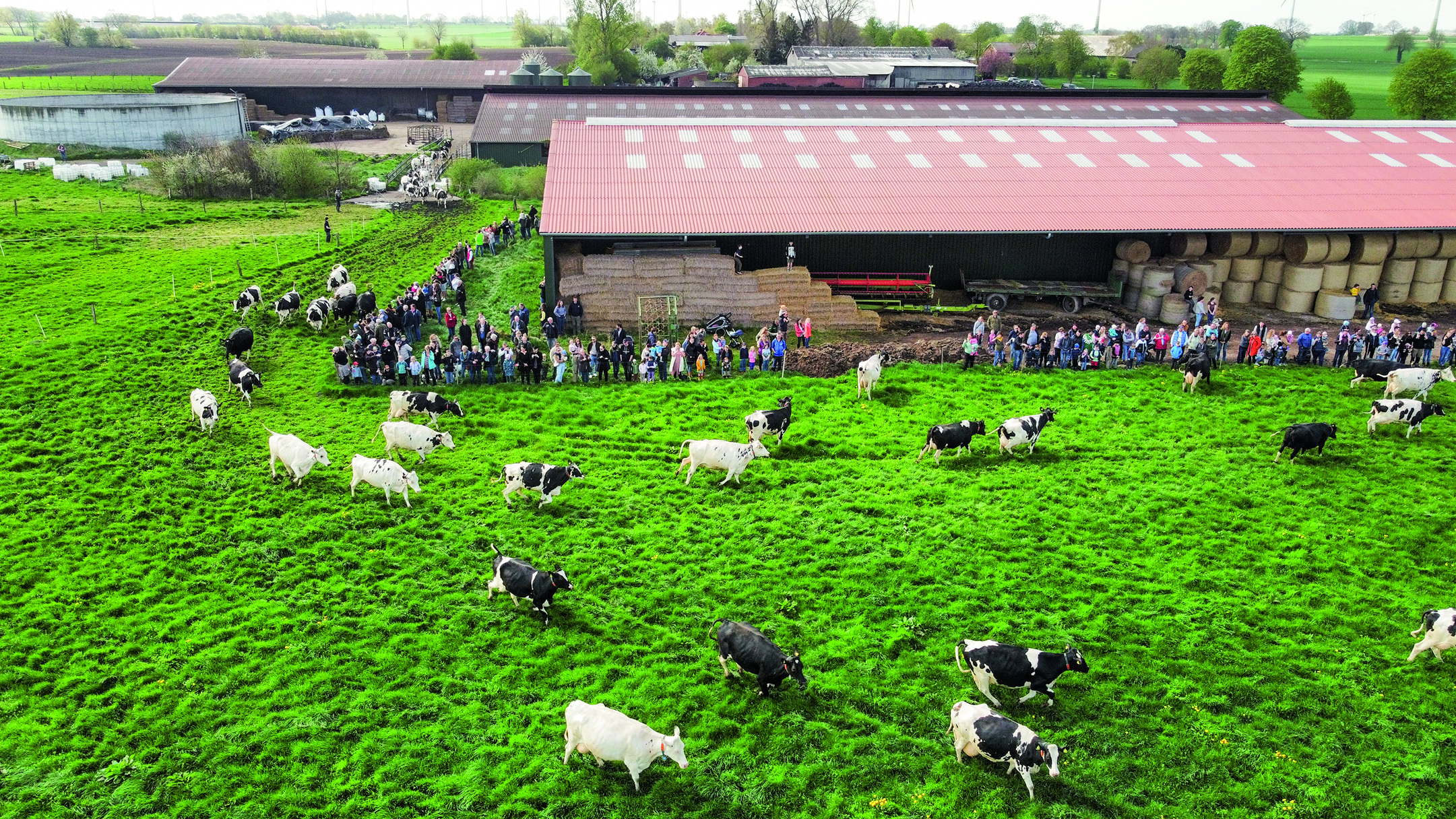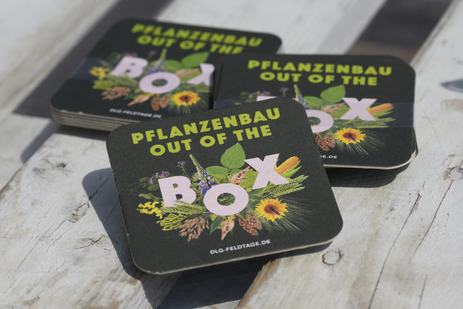- Meinung
- Betriebsführung
- Weltspiegel
- Agrarpolitik
- Ackerbau
- Betriebszweig Schwein
- Betriebszweig Milch
- Steuern
- Markt-Trends
- Pflanzenschutz
- Düngung
- Landtechnik
- Öko
- Alternativen
- Branche
- Erneuerbare Energie
- Nachhaltigkeit
- Tierwohl
- Markt
- Tierhaltung
- Interview
- Digitalisierung
- Welternährung
- Börse
- Auswahl zurücksetzen