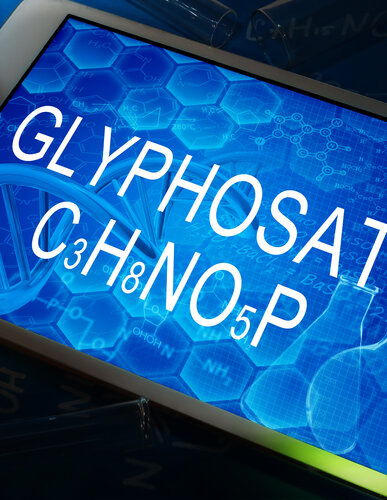Christin Benecke
Editorial
Erntete man früher beim Stichwort Schwanzbeißen nur Schulterzucken und den Verweis auf eine nicht vorhersagbare, von unüberschaubar vielen Faktoren abhängige Verhaltensstörung, hat sich der Tenor mittlerweile geändert. In den vergangenen Jahren wurde in der Praxis viel ausprobiert - möglich nur durch die Deckung der damit verbundenen finanzieller Risiken über Projekte wie die Modell- und Demonstrationsbetriebe (MuD) oder die niedersächsische Ringelschwanzprämie. Der Erfahrungsschatz und das Wissen um das „Wie“ bei der Haltung unkupierter Schweine ist damit erheblich angewachsen. Auch die Forschung wurde intensiviert und hat Hintergründe aufgedeckt, die deutlich mehr Struktur in die Problematik gebracht haben. Damit liegt längs kein „Patentrezept“ gegen Schwanzbeißen auf dem Tisch. Aber die Chancen, langfristig auch in der Breite der Betriebe auf das Kupieren verzichten zu können, sind deutlich gestiegen. In diesem Dossier haben wir Praxiserfahrungen und den Stand des Wissens für Sie zusammengetragen.
Checkliste Kupierverzicht
Das routinemäßige Kupieren der Schwänze von Ferkeln ist verboten. Bevor ein solcher Eingriff vorgenommen wird, sind andere Maßnahmen zu treffen. Die „Checkliste zur Vermeidung von Verhaltensstörungen“ des sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Dr. E. Meyer) zeigt Ansatzpunkte zur Optimierung auf.
Zur Checkliste
Kupierverzicht: Welche Faktoren sind entscheidend?
Wir haben uns beim EPP umgehört und eine Beraterin und einen Landwirt gefragt, was das Erfolgsrezept für die Haltung unkupierter Schweine ist.

Zum Schutz Ihrer Persönlichkeitssphäre ist die Verknüpfung mit dem Video-Streaming-Dienst deaktiviert. Per Klick aktivieren Sie die Verknüpfung. Wenn Sie das Video laden, akzeptieren damit Sie die Datenschutzrichtlinien des Video-Streaming-Dienstes. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien des Video-Streaming-Dienstes finden Sie hier: Google - Privacy & Terms
Kupierverzicht
Tierschutz. Wie nah sind wir dem Ringelschwanz?

Der Kupierverzicht wird politisch weiter vorangetrieben, das zeigt nicht zuletzt die aktuelle Novelle des Tierschutzgesetzes. Doch davon, auf das Kürzen der Schwänze in der Breite der Betriebe verzichten zu können, sind wir weit entfernt. Zu vielfältig sind die Ursachen für Schwanzbeißen und zu hoch ist der Kostendruck.