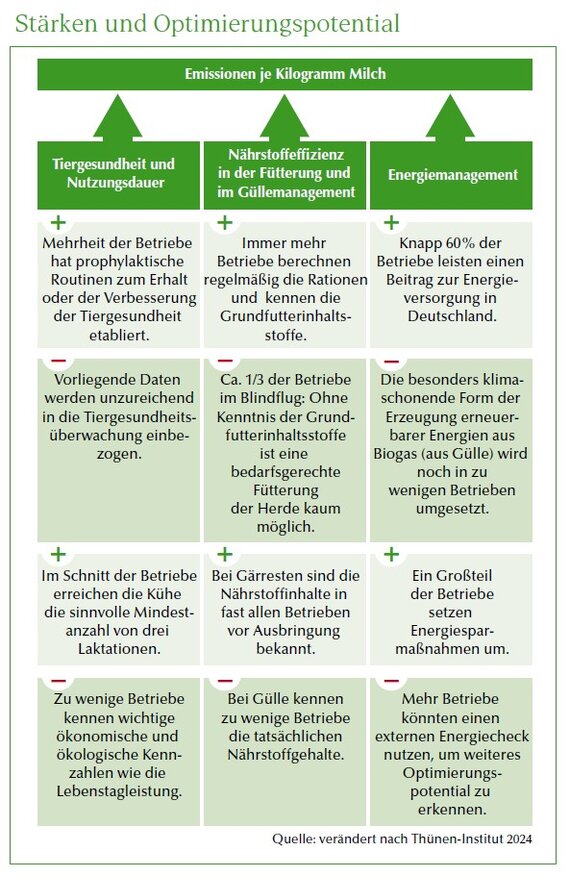Grundfutter II. Effekte auf den CO2-Fußabdruck
Die Qualität und Effizienz entlang der Kette zur Grundfutterproduktion ist mitentscheidend dafür, welche Umweltauswirkungen, Treibhausgasemissionen und Kosten der gesamte Produktionsprozess verursacht. Den Blick für die betriebsindividuellen Stellschrauben zu schärfen, die einen Einfluss auf die Höhe der Emissionen haben, lohnt sich deshalb.
Noch dazu fordern die deutschen Molkereien ihre Milcherzeuger auf, eine Klimabilanzierung durchzuführen. Das Thema Emissionen ist also längst in der Milchviehhaltung angekommen. Doch welche Auswirkungen haben Klimaschutzmaßnahmen auf das Produktionssystem?
Es gibt diverse einzelbetriebliche Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen zur Emissionsminderung. Doch entscheidend sind die damit verbundenen Änderungen der Produktionskosten. Lohnt sich Klimaschutz für die Betriebe? Und wenn nicht: Welche Kosten müssten – im besten Fall – über die Wertschöpfungskette weitergegeben werden?
Die Höhe der Emissionen ist sehr betriebsindividuell. Daher macht es Sinn, sie anhand eines Beispiels zu betrachten: Ein Milchviehbetrieb mit 330 Holstein-Kühen aus einer nordwestdeutschen Grünlandregion bewirtschaftet rund 300 ha und erreicht eine Milchleistung von 10 100 kg ECM (energiekorrigierte Milch) je Kuh und Jahr. Zurzeit liegen die Emissionen bei 1,03 kg CO2-Äq. (Kohlendioxid-Äquivalent) je kg Milch, bzw. 10 414 kg CO2-Äq. je Kuh und Jahr. Bei dieser Rechnung sind die Emissionen aus organischen Böden nicht berücksichtigt.
Um für den Betrieb passende Minderungsmaßnahmen zu identifizieren, ist ein Blick in die Klimabilanz nötig. Die wichtigsten Emissionsquellen je Tier und Jahr sind nach Erhebungen des Thünen Instituts für Betriebswirtschaft:
- Pansenverdauung: 34 %,
- Herstellung der eingesetzten Futtermittel: 29 %,
- Bestandsergänzung und Kälberaufzucht: 24 %,
- Wirtschaftsdünger und Einstreu: 10 %,
- Wasser- und Energieeinsatz: 2 % und
- Dieselverbrauch: 1 %.
Die Maßnahmen sollten so gewählt werden, dass sie in den vier Bereichen für Emissionsreduktion sorgen, die die größten Hebel zur Verringerung der Emissionen haben.
Maßnahmen zur Emissionssenkung
Über verschiedene Wege lässt sich auf die Emissionen aus der Milchproduktion einwirken. Sie unterscheiden sich in Management- und technische Maßnahmen: Zum einen führt der Weg über die Optimierungen des betrieblichen Managements. Gut geführte Betriebe haben dies schon an vielen Stellen getan. Daher sind die Stellschrauben dort nicht mehr riesig, aber trotzdem oft noch nicht vollständig ausgereizt. Weitere Möglichkeiten sind zum Anderen Zusatzstoffe in der Fütterung, die Wirtschaftsdüngerlagerung oder züchterische Maßnahmen, um die Emissionen zu beeinflussen.
Das Erstkalbealter senken.
Die Bestandsergänzung und die Kälberaufzucht machen einen beträchtlichen Anteil der Gesamtemissionen aus. Es lohnt sich deshalb, die Leistungsparameter Erstkalbealter und Remontierungsrate genauer zu betrachten. In welchem Umfang der Betrieb hier Emissionen einsparen kann, hängt stark vom Leistungsniveau der Herde ab. Auf der Hand liegt: Weniger unproduktive Tiere verursachen auch geringere Emissionen. Aktuell hat der 330-Kuh-Betrieb ein durchschnittliches Erstkalbealter von 25 Monaten. Das ist schon ein guter Wert. Unter optimalen Bedingungen lässt es sich aber noch um einen Monat auf 24 Monate reduzieren, so die Annahme für den Beispielbetrieb. Wichtig: Gehen die Färsen zu früh (mit zu geringem Gewicht) in die Produktion, verringert sich ihr Leistungsvermögen. Die Folge sind mehr Emissionen je kg Milch.
Nur mit einem optimalen Herdenmanagement ist diese Gratwanderung möglich, weshalb sich vor allem der Arbeitszeitbedarf erhöht. Zusätzlich wird die Ration der weiblichen Jungtiere mit mehr Kraftfutter aufgewertet, um schneller das betrieblich angestrebte Besamungsgewicht von rund 420 kg LM zu erreichen. Der Betrieb investiert außerdem in eine Wiegeeinrichtung, um gezielt nach Gewicht zu besamen. Die Gesamtkosten der Maßnahmen liegen jährlich bei 13 100 €, bzw. 0,4 Ct je kg Milch.
Die Gesamtemissionen können dadurch aber lediglich um 1,4 %, bzw. 0,01 kg CO2-Äq. je kg ECM gemindert werden. Es ergeben sich aufgrund des geringen Reduktionspotentials hohe Minderungskosten von 272 €/t CO2-Äq.
Die Remontierungsrate verringern
Eine weitere Möglichkeit, die Anzahl unproduktiver Tiere auf einem Betrieb zu reduzieren, ist es, die Remontierungsrate zu senken. Dadurch wird weniger Nachzucht benötigt und die Tiere bleiben länger produktiv im Bestand. Allerdings haben Färsen häufig ein höheres genetisches Potential als Altkühe, sodass eine hohe freiwillige Remontierungsrate für Betriebe ein besseres Ausnutzen des Züchtungsfortschritts bedeuten kann.
Das Minderungspotential ist hier allerdings nicht unerheblich. Im Beispielbetrieb liegt die Remontierungsrate bei 35 %. Ziel ist es, diese auf 25 % zu senken, indem vor allem die unfreiwilligen Abgänge verringert werden. Der Betrieb investiert in ein Tierüberwachungssystem, bestehend aus Halsbandsensoren und zugehöriger Soft- und Hardware, vor allem, um auffällige Tiere frühzeitig zu finden. Für das älteste Drittel der Kühe werden höhere Tierarztkosten angenommen. Insgesamt kostet die Maßnahme 55 000 € jährlich. Je kg Milch bedeutet das Mehrkosten von 1,66 Ct. Das Minderungspotential ist mit 6,9 % der Gesamtemissionen nicht gering. Es ergeben sich aufgrund des hohen finanziellen Aufwands jedoch Minderungskosten von 232 €/t CO2-Äq. Durch die Maßnahme werden je kg ECM 0,07 kg CO2-Äq. vermieden. Sie ist damit etwas günstiger als die Verringerung des Erstkalbealters.
Die Grundfutterqualität steigern
Milchviehbetriebe können durch Optimierungen im Futter- und Herdenmanagement Emissionen einsparen. Eine optimale Grundfuttererzeugung, regelmäßige Rationsberechnungen und Beprobungen der Grundfutterstöcke stellen wichtige Stellschrauben zur Senkung der Emissionen aus der Wiederkäuerverdauung und auch aus der Herstellung der Futtermittel dar.
Eine konkrete Maßnahme ist die Verbesserung der Grassilagequalität. Ziel der Maßnahme ist ein erhöhter Energiegehalt. Dafür investiert der Betrieb in die Grünland-Bestandesführung, führt Erhaltungskalkungen durch, walzt und sät alle Grünlandflächen im dreijährigen Rhythmus nach. Außerdem werden Futterproben in allen Grundfuttersilos im Abstand von sechs Wochen genommen.
Gleichzeitig nehmen wir an, dass der Betrieb wie bisher auf eine Milchleistung von 10 100 kg ECM setzt. Durch die hochwertigere Grassilage kann der Kraftfutteranteil der Ration leicht reduziert werden. Die Maßnahme kostet pro Jahr 25 700 € für das zusätzliche Grünlandmanagement (145 € je ha Grünland), jedoch kann der Betrieb Kraftfutterkosten in Höhe von 29 000 € einsparen. Insgesamt reduziert die Maßnahme unter den getätigten Annahmen die Produktionskosten um 3 300 €, bzw. um 0,1 Ct je kg ECM. Die Emissionen mindern sich nur um 1,2 % bzw. um 0,01 kg CO2-Äq. je kg ECM. Somit ergeben sich Minderungskosten von – 80 €/ t CO2-Äq. Wichtig ist hier das negative Vorzeichen der Minderungskosten: Es bedeutet einen Gewinn von 80 € je eingespartem kg CO2-Äq. Allerdings ist hier die Wetterabhängigkeit hoch, denn trotz optimalen Managements kann unpassendes Wetter hohe Grundfutterqualitäten verhindern.