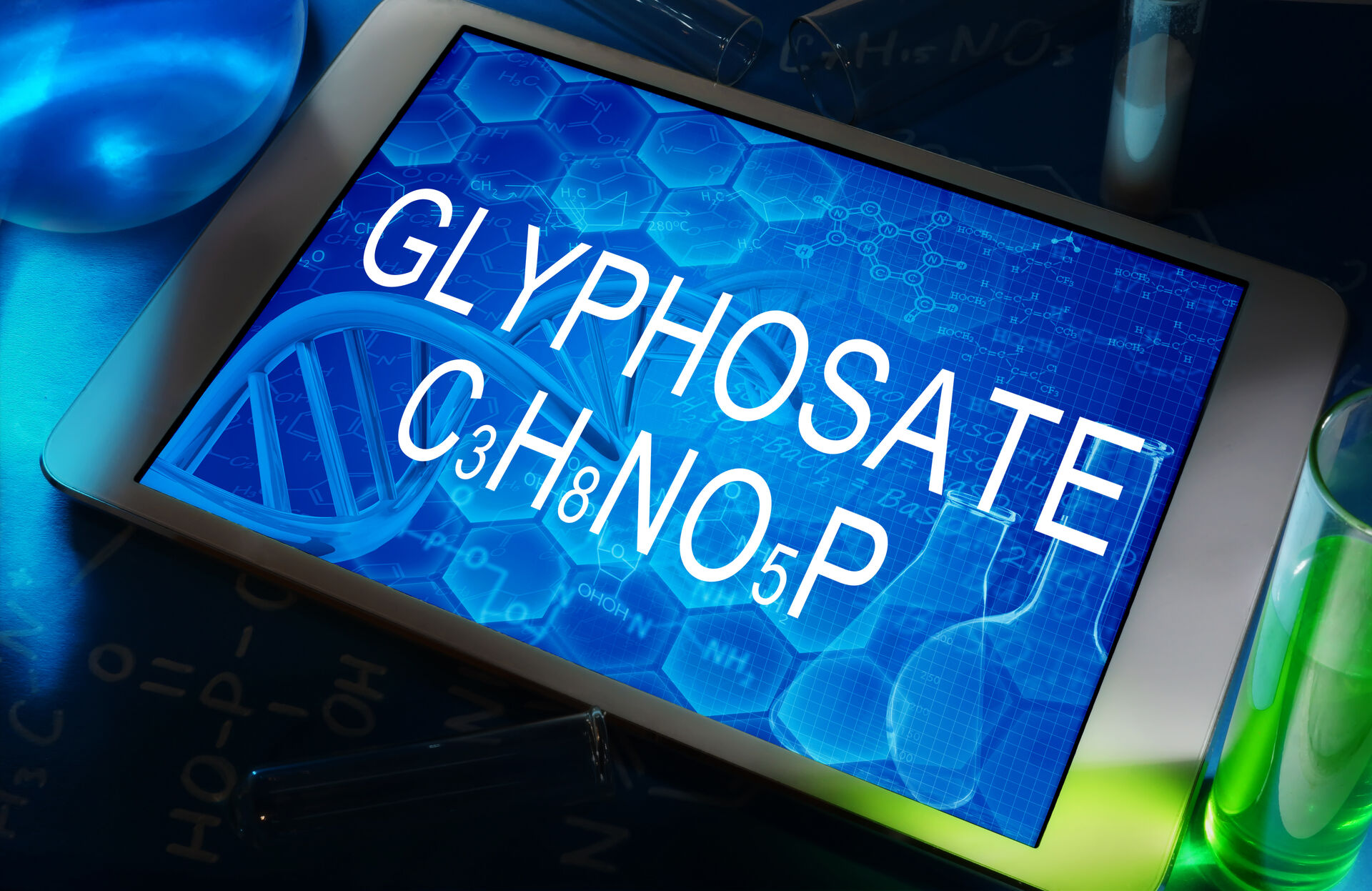Unsere Dossiers
Die Zukunft der Landwirtschaft - An einem Ort. Für Sie aufbereitet. Stetig aktualisiert. Themensicher. Relevant. Meinungsstark.
Dossier
Pflanzenschutz

Kaum ein anderes Thema bewegt die Branche so wie der "Pflanzenschutz". Die Landwirte sind vom Wegfall diverser Wirkstoffe betroffen, sind angehalten mit weniger Mitteleinsatz den gleichen Ertrag zu erzielen (Stichwort 50 Prozent Reduktionsziel) und darüberhinaus verursachen Pflanzenschutzmittel hohe Kosten in den Betrieben. Im folgenden Dossier informieren wie über aktuelle und künftige Themen rund um den chemischen, aber auch mechanischen Pflanzenschutz.
Zum Dossier