Mikrobiom. Wissen, was drin ist
Das Bodenleben ist essentiell für das Pflanzenwachstum. Kann die DNA-Sequenzierung Licht ins Dunkel des Mikrobioms bringen und zukünftig als Entscheidungsbasis für Pflanzenschutz und Düngung dienen? Ferenc Kornis teilt seine Sicht als Pflanzenbauberater.
Probiotika sind nützliche lebende Mikroorganismen. Der Markt bietet bereits eine Vielzahl entsprechender Produkte für die Landwirtschaft. Diese Organismen jedoch gezielt und wirkungsvoll einzusetzen – analog zu Pflanzenschutz- und Düngemitteln, basierend auf Analysen und grenzwertorientierten Empfehlungen – das ist derzeit noch eine Vision. Doch wie realistisch ist diese und welche Hürden sind dafür zu überwinden?
Was wissen wir über unseren Boden und was nicht?
Mitte des 19. Jahrhunderts legte Justus von Liebig den Grundstein der modernen Bodenanalytik. Seither ist klar: Pflanzenernährung beruht auf chemischen Elementen wie Stickstoff, Phosphor und Kalium. Basierend auf nasschemischen Analysen und Feldversuchen entwickelte die VDLUFA Mitte des 20. Jahrhunderts eine Bodenklassifizierung als Grundlage für die gezielte Düngung landwirtschaftlicher Kulturen. Diese lösungsmittelbasierten Analysen sind bis heute Standard in der Bodenanalytik.
Im Ausland, etwa in den USA, ist die Analyse der Kationenaustauschkapazität (KAK) etabliert. Sie erlaubt tiefere Einblicke in Ton- und Humuskomplexe, ist in Deutschland aber wenig verbreitet.
Eine moderne Alternative ist die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS). Schneller, nicht nasschemisch und mit wachsender Datenbasis arbeitet sie zunehmend präzise und hat das Potential, klassische Verfahren langfristig zu ergänzen oder abzulösen.
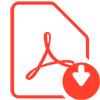
Bodenmikroorganismen und ihre Funktionen - hier gehts zur Übersicht.






